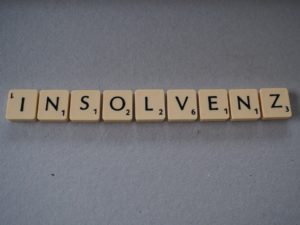
In den allermeisten Fällen, wenn Leute von Insolvenz sprechen, ist von der Privatinsolvenz die Rede. Diese ermöglicht es einer privaten Person, welche weder selbstständig ist bzw. war, ein Verbraucherinsolvenzverfahren einzuleiten, an dessen Ende letztlich die Schuldenfreiheit steht.
Aber wie genau läuft das ab und wie viel muss hierbei eventuell doch selbst von den bestehenden Schulden abbezahlt werden? Dies wird im Folgenden erläutert. Für Unternehmen und Unternehmer gilt ein anderes Insolvenzrecht, welches sich im Ablauf deutlich von dem Verbraucherinsolvenzverfahren für Privatpersonen unterscheidet.
Inhaltsverzeichnis:
Das Verbraucherinsolvenzverfahren
Das Verbraucherinsolvenzverfahren setzt sich aus verschiedenen Schritten zusammen:
- Am Anfang steht die außergerichtliche Schuldenregulierung. Die Durchführung ist nach §305 der Insolvenzordnung verpflichtend und muss mit Nachweisen belegt werden.
- Erst wenn die Schuldenregulierung nicht erfolgreich ist, wird das Insolvenzverfahren eröffnet. Dazu reicht der Schuldenberater die Bescheinigung des Scheiterns der außergerichtlichen Schuldenregulierung, den Antrag auf Restschuldbefreiung, Antrag auf Stundung der Verfahrenskosten, Vermögensverzeichnis des Schuldners, Gläubiger- und Forderungsverzeichnis sowie einen Schuldenbereinigungsplan ein.
- Bereinigungsplan und Vermögensaufstellung des Schuldners werden an die Gläubiger geschickt, diese müssen dem Verfahren zustimmen. Sind mindestens 50 % einverstanden, kann das Gericht die Zustimmung der anderen Gläubiger auf Antrag ersetzen.
- Zu Beginn wird vom Gericht ein Insolvenzverwalter eingesetzt. Dieser erstellt eine Insolvenztabelle und pfändet den pfändbaren Teil des Vermögens. Dieser wird dann veräußert und aus dieser Vergütung werden die Verfahrenskosten gedeckt, der Restbetrag wird an die Gläubiger verteilt.
- Das Gerichtsverfahren benötigt etwa 1 Jahr, danach folgt die sogenannte Wohlverhaltensphase, deren Dauer 6 Jahre beträgt. Der Schuldner muss in dieser Zeit einige Verpflichtungen erfüllen (zum Beispiel, dass er jede zumutbare Arbeit annimmt). Vom Einhalten dieser Verpflichtungen hängt der weitere Verlauf des Verfahrens ab.
- Am Ende der Wohlverhaltensphase steht idealerweise die Restschuldbefreiung. Im Gegensatz zum Namen wird aber die Schuld in sogenannte unvollkommene Verbindlichkeiten (Naturalobligationen) umgewandelt. Dadurch erlischt sie zwar nicht, aber der Schuldner ist berechtigt, die Leistung zu verweigern.
Was ist Selbstbehalt bei Insolvenz?

Der Selbstbehalt bei Insolvenz sichert dem Schuldner während der Insolvenz sein Existenzminimum zu.
Die Höhe der Pfändungsgrenze liegt im Jahr 2019 bei 1139,99 Euro. Sofern der Schuldner für weitere Personen – wie zum Beispiel Kinder – unterhaltspflichtig ist, erhöht sich der Freibetrag.
Der Schuldner verpflichtet sich im Insolvenzverfahren, seine gesamten Einkünfte wahrheitsgemäß offen zu legen. Aus diesen Einkünften generiert der Insolvenzverwalter die Beträge, die während der sogenannten Wohlverhaltensphase an die Gläubiger zurückgeführt werden.
Da aber der Schuldner selbst auch während dieser Zeit in der Lage sein muss, seine Lebenshaltungskosten zu tragen, wird ihm der Freibetrag zugestanden. Dieser wird somit nicht an die Gläubiger abgetreten, sondern der Schuldner darf diesen behalten und darüber frei verfügen.
Privatinsolvenz: Selbstbehalt-Rechner
Rechner für den Selbstbehalt gibt es viele. Solange man keine unterhaltsberechtigten Personen hat ist es recht einfach, denn dann gilt der normale Freibetrag. Für die Berechnung mit Unterhaltsberechtigten kann man sich über das Internet entsprechende Rechner suchen, zudem kann der Schuldnerberater oder die Verbraucherzentrale hierbei weiterhelfen.
Wichtig bei Eigenrecherche im Internet ist, darauf zu achten, dass man hierfür Seiten verwendet, welche von offiziellen Stellen wie Anwälten oder Schuldnerberatungen stammen, sodass die erhaltenen Ergebnisse auch zuverlässig sind.
Aktuelle Pfändungstabelle

In Pfändungstabellen werden die Obergrenzen für das persönliche Arbeits- und Sozialeinkommen festgelegt. Diesen Betrag darf der Schuldner trotz einer Pfändung in jedem Fall behalten.
Zu Beginn 2019 beträgt dieser Betrag pro Monat 1139,99 Euro. Verdient ein Schuldner monatlich mehr als diesen Betrag, wird ein Teil des mehr verdienten Geldes an die Gläubiger abgeführt (das kann man dann aus der Tabelle entnehmen).
Verdient ein Schuldner mehr als 3480 Euro, wird der gesamte darüber liegende Betrag an die Gläubiger verteilt. Der Betrag wird, wie der Freibetrag, regelmäßig angepasst.
Die genannten Zahlen gelten nur eine bestimmt Zeit und können somit von den eigentlichen Beträgen abweichen. Welche Beträge an welchen Gläubiger gehen, legt der Insolvenzverwalter anhand der Höhe der Gesamtschulden fest.
Pfändungsfreigrenze für Verheiratete
Ehepartner spielen für den Pfändungsfreibetrag zunächst keine Rolle, zumindest solange diese selbst erwerbstätig sind oder in irgendeiner Form ein Einkommen beziehen. Nur wenn der Ehepartner keinerlei eigenes Einkommen hat, erhöht sich dadurch auch der Pfändungsfreibetrag.
Der Ehepartner ohne eigenes Einkommen zählt in dem Fall wie ein unterhaltsberechtigtes Kind und der Betrag erhöht sich dementsprechend gemäß der aktuellen Pfändungstabelle für eine Person, der man unterhaltsverpflichtet ist.
Verheiratet sein alleine beeinflusst jedoch nicht die Grenzen dieser Beträge. Genau genommen kann je nach Veranlagung in der Ehe das Einkommen des Ehepartners sogar ebenfalls Teil der Pfändung werden, sollten die Schulden innerhalb der Ehe entstanden sein und beide dafür unterschrieben haben.
Die Situation ist also etwas komplexer und bedarf in der Regel einer fachkundigen Beratung. Am besten lässt man sich vor der Eheschließung bei einem Anwalt für Familienrecht über die Vorzüge und Nachteile der einzelnen Formen der Ehe informieren und darüber, in wie weit welche Dinge zum Beispiel auch per Ehevertrag vorab geregelt werden sollen.